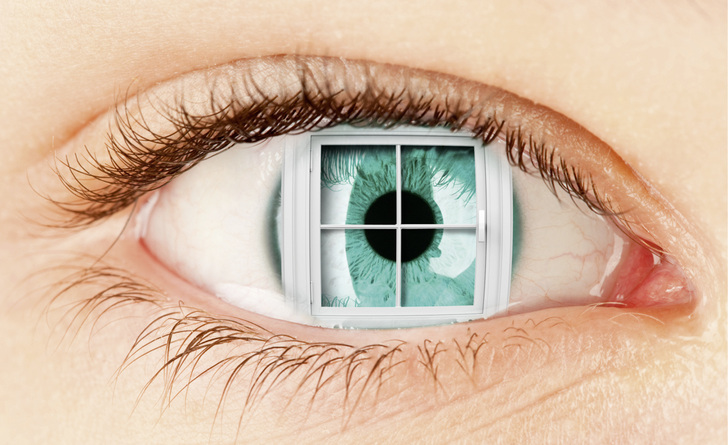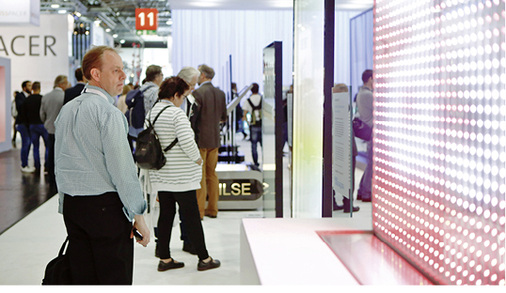_ Wenn wir also jetzt nach vorne blicken in die ungewisse Zukunft, gibt es immer zwei Möglichkeiten: Wird uns schwindelig und haben wir das Gefühl, dass sich die Realität immer konkreter den Science-Fiction-Vorstellungen annähert oder sind wir gegenüber den spannenden Entwicklungen aufgeschlossen. Eines ist jedoch gewiss: Diese Zukunft lässt sich nicht aufhalten, egal wohin wir uns entwickeln. Insofern bleibt uns vor allem die Möglichkeit, diese Entwicklungen zu begleiten und ein Stück auch noch selbst zu beeinflussen.
Angesichts dessen lohnt sich doch ein Rückblick auf die vergangenen Monate des Jahres 2016. Die große Produktschau auf der FENSTERBAU/FRONTALE in Nürnberg brachte einiges zutage, was tatsächlich auch in naher Zukunft in marktfähigen Produkten umgesetzt werden wird: Schließlich werden das Fenster, die Haustür und auch andere Bauelemente der Zukunft mit mehr Funktionen aufgeladen sein. Und das dieses Bauelement natürlich auch energieeffizient ist – das wird schon gar nicht mehr thematisiert. Davon wird ausgegangen. Es geht also vielmehr um andere Eigenschaften wie die Optik, die Haptik, aber auch um technische Lüftungslösungen und immer stärker auch um den Einbruchschutz.
Ganz intensiv werden sich aber auch Gedanken gemacht, wie man das Fenster der Zukunft in die Hausautomation integrieren kann. Die Digitalisierung am Fenster ist also bereits im vollen Gange und auch nicht mehr aufzuhalten.
Und auch auf der zweiten wichtigen Branchenmesse des Jahres, auf der glasstec, war die Digitalisierung ein vorherrschendes Thema. Das zeichnet sich, so der Redaktionskollege Matthias Rehberger, „bei den neuen Entwicklungen im Segment Glasanwendungen für Fassade und Interieur ebenso deutlich ab, wie im Maschinen- und Anlagenbau – Stichwort Industrie 4.0“.
Im Folgenden blicken wir über den konkreten Horizont des Marktes. Es geben Zukunftsforscher und Trendbeobachter ihre Statements ab, welche Veränderungen der Lebensumstände und Wohn- und Sicherheitsbedürfnisse auf uns zukommen werden.
So bekommen die Branchenbeteiligten Hinweise, auf was man sich produktseitig und auch organisatorisch einzustellen hat. —
Verena Muntschick: „Healing Architecture“ rückt in den Vordergrund
Kaum etwas bestimmt unser Leben so sehr wie die Räume, die uns umgeben. Gut konzipierte und gebaute Räume inspirieren uns, wirken befreiend, helfen uns, fokussiert und gesund zu bleiben. In den vergangenen Jahren haben die Themen Bauen, Wohnen und Gestaltung von Räumen, außen wie innen, eine dramatische Renaissance erlebt. Die Beschäftigung mit dem, was uns die allermeiste Zeit dieses Daseins umgibt, gewinnt kontinuierlich an Bedeutung. Dabei rückt ein Faktor immer mehr in den Vordergrund: „gesundes” Bauen. Gebäude leisten in Zukunft einen zentralen Beitrag zur Gesundheit der Menschen. Das erfordert eine Veränderung im Denken, da Baustoffe und Bauteile dadurch eine andere oder zumindest eine erweiterte Funktion bekommen.
Aktuell lebt etwa jeder sechste EU-Bürger (15,7 %) im Schnitt in einer feuchten, von Schimmel bedrohten Wohnung. In einer Vielzahl von Gebäuden sind immer noch gesundheitsschädliche Substanzen verarbeitet. Doch der Trend zum Bauen mit gesunden Materialien wächst. Von Baustoffen und Häusern wird unter dem Einfluss des Megatrends Gesundheit nicht mehr nur verlangt, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind, sondern sie sollen einen gesundheitlichen Mehrwert erzeugen. Hier tritt als gesunder Baustoff neben Holz zum Beispiel auch Lehm in den Vordergrund: Geschätzt wird er vor allem wegen seiner feuchtigkeitsregulierenden und Luftaustausch fördernden Funktion, die frische Luft auch im Inneren gewährleistet.
Baustoffe mit Zusatznutzen werden künftig zum Standard, wo Menschen von den Gebäuden, in denen sie sich aufhalten, verlangen, dass sie einen Beitrag zur Gesundheit der Bewohner und der Umwelt leisten.
Das Verständnis von Gebäuden verändert sich damit grundlegend: Von einem passiven Abschottungsraum werden sie zu einem offenen, aktiven Teil einer gesunden Stadt.
Wände, Fassaden und Fenster werden zu lebendigen, verbindenden Elementen zwischen innen und außen, statt die beiden Atmosphären voneinander zu trennen.
Dies sowohl was Feuchtigkeitsregulation und Belüftung betrifft, als auch den Einfall von Tageslicht: Anstatt Tageslichtlampen im Inneren zu installieren, ist es das Ziel der Architekten und Hausplaner, dass die Menschen auch innerhalb offen konzipierter Gebäudestrukturen die Gelegenheit haben, gesunde Strahlen zu genießen. Auf diese Weise wird es den Menschen ermöglicht, in einem gesundheitsrelevanten Bezug zu ihrer Umgebung zu bleiben, auch wenn sie sich – wie die meiste Zeit ihres Lebens – innerhalb von Gebäudekomplexen aufhalten.
Auch für die Umweltgesundheit werden Gebäudefassaden lebendig: Ebenso wie moderne Straßenbeläge sollen sie Lärm schlucken können und damit den Stadtbewohnern einen Gesundheitsdienst erweisen. Die immer häufigeren Vertikalgärten an Fassaden liefern nicht nur einen Beitrag zur Wohlfühlatmosphäre der Menschen, sondern dienen gleichzeitig der Umgebungsreinigung, da Pflanzen CO2 zu ihrem Wachstum verarbeiten.
In vielen modernen Konzepten werden Außenwände auch als Photovoltaik-Träger und damit als energieerzeugende Fläche genutzt. Damit werden sie zu einem integrativen Bestandteil einer neuen Energiepolitik, bis hin zu energieautarken Häusern oder Blöcken, die Strom sogar abgeben können. Jedes Haus wird so im Kleinen zu einem selbstregulierenden, unabhängigen und produktiven und vor allem umweltfreundlichen und damit gesundheitsförderlichen Ökosystem.
Deutschland ist neben Großbritannien und Frankreich eines der führenden Länder in Sachen nachhaltiges Bauen. Der gesamte umweltrelevante Markt für Bau und Stadtentwicklung liegt in Deutschland mittlerweile bei 83 Mrd. Euro, der allein für energieeffiziente Gebäude liegt weltweit bei 126 Mrd. Euro – mit der Erwartung, dass er sich bis zum Jahr 2025 verdoppeln wird.
Angela Hengsberger:„Das Fenster der Zukunft steht völlig offen“
Ein erfolgreiches, fertiges Produkt ist nichts anderes als eine in Form gegossene Befriedigung von Bedürfnissen. Auf die Frage, nach dem Aussehen und den Eigenschaften des Fensters der Zukunft muss deshalb eine weitere folgen: Wessen Bedürfnisse muss das Fenster in Zukunft denn befriedigen? Die des Nutzers natürlich, möchte man einwerfen. Diese Antwort ist unvollständig. Denn: Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Bewohner eines Gebäudes oder einer Wohnung „sein“ Fenster verwenden kann, müssen zahlreiche Glieder einer Wertschöpfungskette ihre Arbeit erledigt haben. Und jedes Glied dieser Kette hat ganz eigene Anforderungen und Bedürfnisse an das Produkt, das er weiterverarbeitet. Es sind also nicht bloß die Bedürfnisse des Endnutzers, welche die Weiterentwicklung des Fensters bestimmen. Sondern die Anforderungen aller Glieder der Wertschöpfungskette bestimmen letztendlich, wie das Fenster der Zukunft aussehen wird. Deshalb lohnt es sich, die Wertschöpfungskette beim Fenster genauer zu analysieren.
Hier gibt es zunächst einmal die Industrie, die Komponenten wie Glas, Profile, Beschläge und Dichtungen herstellt. Für einige dieser Komponenten, etwa Profile, gibt es einen Großhandel. Andere wie Fenster-Profile gelangen direkt vom Hersteller an das nächste Glied in dieser Kette.
Das sind die Fensterbauer. Davon gibt es in Deutschland etwa 6000. Diese Betriebe fertigen nicht industriell, sondern hauptsächlich in Handarbeit. Dieser Zweig ist einem hohen Wettbewerbsdruck aus Märkten ausgesetzt, in denen wenige Großbetriebe die Komponenten in industriellen Verfahren zusammensetzen. In Polen ist dies der Fall. Aber auch in Österreich gibt es große Hersteller, wie etwa Internorm, die größte international tätige Fenstermarke.
Welche und wie viele Fenster in ein Gebäude eingebaut werden sollen bestimmt der Bauherr. Wenn das Gebäude ein Architekt geplant hat, dann hat der Bauherr den Vorgaben des Architekten zu folgen. Die fertigen Fenster in ein Gebäude einzubauen, ist dann Sache des Fenstermonteurs. Und ganz am Schluss dieser Kette steht der Nutzer: Also der Mieter, der Hotelgast oder der Arbeitnehmer.
Die Dynamik: Jedes einzelne Glied dieser Wertschöpfungskette ist Veränderungen unterworfen. So ist es absehbar, dass sich die kleinstrukturierte Branche der Fensterbauer in Deutschland stark verändern wird. Die handwerklich strukturierten Betriebe sind starker Konkurrenz ausgesetzt und oft hat die Nachfolgegeneration des Firmeneigentümers gar keine Lust, sich dieses harte Geschäft noch weiter anzutun. Eine Konsolidierung erscheint wahrscheinlich. Größere Betriebe, die industriell fertigen, haben aber völlig andere Bedürfnisse an die ihr vorgelagerte Wertschöpfungskette – der Industrie und dem Großhandel.
Einige der kleinen Fensterbauer könnten auch vertikal differenzieren. Sie könnten also versuchen, Fensterprofile selbst herzustellen, um individuellere Fenstermodelle anbieten zu können. Ihre Bedürfnisse an die Glas- und Beschlägelieferanten würden sich dadurch fundamental ändern.
Die Bedürfnisse der Bauherren an das Fenster verändert sich so, wie sich Moden und Strömungen in der Architektur verändern. Trends, wie etwa jener zu immer schmäleren Fensterprofilen, beeinflussen alle Glieder der vorgelagerten Wertschöpfungskette. In so manchem Bauwerk avancieren die Fenster überhaupt schon zur Fassade. Fensterprofile sind dadurch überflüssig.
Es ist also durchaus möglich, dass Glieder der Wertschöpfungskette, wie etwa die Profilhersteller, stark unter Druck geraten.
Der Konsument sprengt die Ketten: Eine Analyse oder Prognose der teils fundamentalen Veränderungen in der Wertschöpfungskette der Fenster reicht allein nicht aus, um Rückschlüsse auf die Bedürfnisse und somit das endgültige Produkt „Fenster“ zu ziehen. Der Grund ist der immer mündigere Verbraucher, der viel mehr Ansprüche an das Fenster stellt, als noch vor einigen Jahren. U-Wert hin, individuelles Design her: Im Zeitalter von Internet of Things und Smart Home fragt sich der Benutzer: Warum kann ich eigentlich kein intelligentes Fenster haben? Eines, das während meiner Abwesenheit dafür sorgt, dass mich beim Betreten meines Hauses frische Luft empfängt. Eines, das meinen Energieverbrauch intelligent reduziert. Oder eines, das sich auf mein Kommando öffnet oder schließt.
Sobald ein Ding „smart“, also vernetzt ist, reihen sich völlig neue Player in die Wertschöpfungskette ein. Denn eine Vernetzung funktioniert nur auf Basis von bestimmten Standards – oder besser gesagt Plattformen. Die Big-Player der modernen Plattformökonomie wie Google, Amazon oder Apple drücken spätestens mit dem Launch ihres Home-Assistenten auch der Fensterbranche ihren Stempel auf. Denn Amazon Echo oder der Google Assistent vermögen es nicht nur auf Sprachbefehl ihres menschlichen Frauchen oder Herrchen die gewünschte Musik oder Blockbuster abzuspielen oder Antworten auf einfache Fragen wie etwa dem Wetter zu geben. Sie steuert auch Lampen, Lichtschalter, Thermostate – warum deshalb auch nicht Fenster?
Schnittstellen werden diktiert: Das Fenster der Zukunft muss also so gebaut werden, dass es den Schnittstellen, die Google und Co vorgeben, entspricht. Denn kein Fensterbauer – sei er noch so groß – wird mit einem eigenen System Erfolg haben können. Er müsste in ein völlig neues Geschäft einsteigen, in dem es um die Vernetzung und Auswertung von Unmengen an Daten geht. Die Big Player hier herauszufordern wäre dumm. Anders gefragt:
Wer würde sich eine App von Internorm herunterladen, um seine Fenster zu steuern, wenn er von Google eine Lösung nutzen kann, die sein gesamtes Haus steuert?
Noch dazu, ohne dem System viel sagen zu müssen. Denn sofern vom Nutzer gestattet, weiß Google nach einer bestimmten Zeit selbst, wann der Nutzer nach Hause kommt, wo er sich gerade befindet und wie lange er sich in der Wohnung aufhalten wird. Es ist also absehbar, dass sich mehr oder weniger alle, die am Bau und Einbau eines Fensters beteiligt sind, irgendwie mit den Plattformen der Großen arrangieren müssen. Das ist keine gute Nachricht, denn das macht jedes Unternehmen abhängiger. Abhängiger von demjenigen, der über den Kontakt zum Endnutzer und damit seine Daten verfügt – und das ist eben Google, Apple, Amazon und Co.
Plattform für Baumodule: Es gibt andere Formen der Plattformökonomie, die sich auf das Fenster der Zukunft sehr stark auswirken können. Denn Plattformökonomie bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein Großer alles kontrolliert und am meisten profitiert. Es gibt Modelle, in denen sich jeder Teilnehmer nicht nur einbringen kann, sondern auch Nutzen und Gewinn aus dem gemeinsamen Ganzen ziehen kann. An einem solchen Modell arbeitet der Vorarlberger Bauunternehmer Hubert Rhomberg. Der Geschäftsführer der Rhomberg Gruppe will mit dem eigens gegründeten Unternehmen Creative Resource & Energy Efficiency (CREE) die Baubranche digitalisieren. Der Kern von Rhombergs „Bauen 4.0“ ist eine Plattform, auf der sich Millionen behördlich genehmigte Bauteile befinden. Die Datenbank beinhaltet zu jedem diese Bauteile eine genaue technische Dokumentation, Verfügbarkeiten und Ökobilanzen. Mit diesen Bauteilen können Architekten, Stadtplaner, Techniker und Inneneinrichter ein digitales Gebäudemodell entwerfen. Sobald die Planung fertig ist, kann der Bau organisiert werden.
Dezentrales Produzieren: Die verwendeten Bauteile können dabei Firmen herstellen, die sich in der Nähe des Bauplatzes befinden. Die notwendigen Daten dafür sind ja auf der Plattform zu finden. Im Bauplan ist auch festgelegt, wann welches Bauteil an Ort und Stelle sein muss. Die Verwendung von Modulen und die effiziente Planung macht das Bauen unheimlich schnell: Rhomberg selbst hat es geschafft, ein acht Stockwerke umfassendes Gebäude in acht Tagen mit nur fünf Bauarbeitern zu errichten. Inklusive Innenausstattung. Dieses Gebäude, der LifeCycle Tower one, steht in Dornbirn und weist eine weitere Besonderheit auf: Es besteht zu großen Teilen aus Holz. Deshalb, weil es keinen Ressourcen schonenderen Baustoff gibt. Mit der Digitalisierung der Baubranche will Rhomberg selbige vor allem ökologischer gestalten. Der Unternehmer versteht ein Bauwerk nicht mehr als fertiges Produkt, sondern als eine modulare Konstruktion, in der man veraltete oder schadhafte Teile wie Fassaden oder eben auch Fenster austauschen kann. Damit erhöht sich die Lebensdauer des Baus auf bis zu 150 Jahren. Rhombergs Bauwerke haben das Internet der Dinge fix an Bord. Lampen, Sensoren, Fenster und Mikrophone können sich untereinander „unterhalten“ und somit ist ein ganzes Gebäude per App steuerbar.
Dass ein Bauen 4.0, wie es Hubert Rhomberg vorschwebt, fundamentale Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette beim Fensterbau haben wird, leuchtet ein. Ob sich der innovative Ansatz für nachhaltiges Bauen des Vorarlbergers durchsetzt, bleibt indes abzuwarten. Und mit welchen Innovationen Google, Apple, Amazon und Co aufwarten werden, ist nicht abschätzbar. Dies lehrt die Vergangenheit. Novitäten, die das Fenster, sein Aussehen und seine Herstellung massiv beeinflussen werden, werden sicherlich darunter sein. Denn die Zukunft liegt in der Vernetzung – und das Fenster ist ein Teil dieses Netzes. Wie werden also die Fenster der Zukunft aussehen? Das lässt sich nicht sagen. Wie auch, wenn es heute noch nicht einmal absehbar ist, wer das in Zukunft erledigen wird.Angela Hengsberger
—
DGNB-Stellungnahme zum Klimaschutzplan 2050
In einem umfangreichen Dialogprozess wird seit vergangenem Jahr von der Bundesregierung der Klimaschutzplan 2050 entwickelt, in dem die nationalen Ziele und Empfehlungen zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele formuliert und damit auch verbindlich festgesetzt werden sollen. Zum letzten Hausentwurf, der hierzu veröffentlicht wurde, hat die DGNB eine offizielle Stellungnahme eingereicht. Einige Punkte aus der Stellungnahme werden im Folgenden skizziert:
- Für den Bau- und Immobilienbereich sollte als Ziel formuliert sein, dass die gebaute Umwelt wesentlich dazu beiträgt, ein stabiles Klima mit nicht mehr als 1,5 bis 2 °C Temperaturerhöhung zu erreichen. Im Rahmen der vorliegenden Definition des Leitbildes für 2050 und der Meilensteine für 2030 möchten wir die Bundesregierung zudem dazu ermutigen, nicht nur „nahezu“, sondern tatsächlich CO<sub>2</sub>-neutrale Gebäude zu fordern. Ein treibhausgasneutraler Gebäudebetrieb ist bereits heute keine Utopie, sondern Teil unserer gebauten Umwelt.
- Besonders im Gebäudebereich lässt sich wirtschaftlich sehr viel erreichen. Dies muss jetzt genutzt werden; auf einen „fairen“ Verteilungsschlüssel entsprechend der aktuellen Lasten kann und darf nicht gewartet werden. Wichtig hierfür: Private Investitionen und staatliche Förderungen müssen zukünftig auf das Erreichen von konkreten Klimaschutzzielen ausgerichtet sein.
- Im Klimaschutzplan werden nacheinander die Themen Mobilität, Urbanisierung, barrierefreies Bauen, ressourcenschonendes Bauen, Vermeidung von Gefahrstoffen, Nutzungsdauer und Qualität abgearbeitet. Die Tatsache, dass alle Themen gleichzeitig planungsrelevant sind und nur in einem Zusammenhang miteinander betrachtet und bewertet werden können, bleibt nach wie vor unberücksichtigt.
- Hinzu kommt, dass in diesem Teil nur Bezug genommen wird auf Neubauten, der Bestandsbau findet hier keine Erwähnung. Dies greift zu kurz, da im Bestand die deutlich größeren Hebel für den Klimaschutz liegen.
- Bei der Frage nach der Wirtschaftlichkeit für Mieter und Eigentümer sollte es nicht darum gehen, die Zahl bekannter Techniken zur Energieeinsparung weiter zu steigern, sondern eine neue Bewertungsstrategie auf Grundlage der ökobilanzierten Umweltwirkung GWP einzuführen. Damit werden sich neue oder andere Techniken als wirtschaftlicher erweisen.
- Technologiefreiheit muss als oberstes Credo bei der Förderung von konkreten Maßnahmen angewandt werden. Da jedes Gebäude für sich steht, wirken bei jedem Gebäude an seinem Standort verschiedene maximal effektive Maßnahmen. Dies ist bei Fördermaßnahmen zu beachten. Nur durch Technologiefreiheit können die notwendigen weiterführenden Innovationen angestoßen werden und eine weiterhin vielfältige gebaute Umwelt erhalten bleiben.
Interview mit Katja Korehnke
GLASWELT – Glas- und Fassadenhersteller testen neuartige Materialien und Verfahren und berichten darüber. Reicht das aus, um zukunftsfähig zu sein?
Katja Korehnke – Die Hersteller sind in der Tat sehr aktiv. Das Problem ist aber, dass sie bei der Entwicklung weiterhin vor allem durch die Ingenieurs-Brille schauen. Es gilt noch immer die Maxime, ein Produkt minutiös abzusichern, bevor es auf den Markt kommt. Es muss am besten zu 120 Prozent funktionieren und sicher sein. Bis der Kunde es zum ersten Mal sieht, können daher Jahre vergehen. Die Digitalisierung und die Geschwindigkeit, die sie in den Markt bringt, wirbelt diese Denke nun gehörig durcheinander. Kommt das ausgereifte Produkt auf den Markt, kann der Stand der Technik längst ein anderer sein. Die inzwischen mögliche sensorgesteuerte Vernetzung von Mensch und Maschine hat zudem entlang der gesamten Wertschöpfungskette Konkurrenten auf den Plan treten lassen, die traditionelle Anbieter bislang gar nicht kannten. Vor allem aber haben sich die Ansprüche der Kunden geändert. Durch das Internet wird vieles transparenter – der Preis, das Produkt, die Features. Und Kunden werden ungeduldiger und fordern einen sofort sichtbaren Mehrwert ein.
GLASWELT – Der Mittelständler muss also näher an den Endkunden?
Korehnke – Unbedingt. Unternehmen müssen verstärkt vom Kunden nicht von einem Produkt aus denken. Zuhören ist hier das Stichwort. Denn ob ein Kunde sich für den Kauf eines Produktes entscheidet oder dagegen, hängt davon ab, ob das Unternehmen die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kunden erkannt hat. Dabei gilt es, nicht nur das Produkt, sondern die gesamte Wertschöpfung zu betrachten. Der Anbieter muss sich fragen, ob er seine Kunden bei all ihren Aktivitäten unterstützt. Angefangen bei der Installation über die Wartung bis zur Entsorgung.
GLASWELT – Sie postulieren Wandel als Chance. Wie kann ein etabliertes Unternehmen mit festen Strukturen diesen Veränderungsprozess einleiten?
Korehnke – Ich sage nach wie vor: Gebt einem deutschen Ingenieur ein Problem und er wird es lösen. Nur halt nicht mehr allein, sondern in Kooperation mit anderen Playern aus anderen Disziplinen, die zum Beispiel ihr Knowhow in Sachen digitale Geschäftsmodelle oder Benutzerführung einbringen. Das ist schon deshalb wichtig, um die mit der Digitalisierung einhergehenden Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Ganz allgemein ist Innovations- und Anpassungsfähigkeit aber vor allem eine Frage der Unternehmenskultur. Die Geschäftsführung und das Top-Management müssen umdenken und eine offenere Innovations- und Kommunikationskultur etablieren. Sie müssen das Mindset im Unternehmen ändern. Hier setzen wir bei unserer Beratung zuerst an und begleiten die Unternehmen durch den Veränderungsprozess.